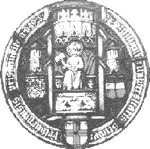
Nach 12-stündigem Flug von Frankfurt 22.35 (man muss 3 Stunden vorher in FRA sein, d.h. Abfahrt in Freiburg um 16 Uhr) komme ich (mit 5 Stunden Zeitverschiebung) um 5.15 in Sao Paolo an. Mein Flugnachbar ist –erkennbar - ein Berg-Norditaliener, aus Bergamo. Wir kommen ins Gespräch, er fliegt nach Sao Paolo, um bei einer katholischen Veranstaltung teilzunehmen. Er ist ein Verkäufer von Devotionalien und religiösen Stoffen für Priester, und er hat dies alles im Gepäck. So kommt er zum zweiten Mal nach Brasilien, um hier seine Waren anzubieten. Er spricht kein portugiesisch, noch eine andere Sprache als Italienisch, meint aber er käme gut mit dem Dizionario und seinem Italienisch durch. Das lässt mich auch hoffen. Glücklicherweise habe ich nicht den Anschlussflug 2 Stunden später nach Florianopolis genommen, sondern erst den fast 7 Stunden späteren um 11.50, denn obgleich das Flugzeug pünktlich ankommt, verbringe ich zunächst 1, 5 Stunden in der Warteschlange der Einreise- und Zollabfertigung, und dann weitere 1,5 Stunden in der einzigen! Warteschlange für Inlandsflüge, aber das um 5.30! Als ich mit der Prozedur fertig bin, ist die Schlange leicht doppelt solang, d.h. zieht sich durch den ganzen Flughafen zweier Terminalbereiche - ich denke, dann mindestens 3 Stunden Wartezeit.
Das Wetter ist ziemlich schlecht, aber es regnet jedenfalls nicht und die Wolkendecke hängt relativ hoch, und auch wenn es etwas diesig ist, sieht man etwas. Vom Flughafen aus sieht man die welligen Hügel, deren Horizonte die typischen Formen der tropischen Vegetation haben: es sind bizarre Formen der Baumkronen und Äste, mit wenigen großen Blättern, die sich aber nach oben drängen, während unsere Bäume stärker gleichverteilten Bewuchs haben oder wie die Koniferen konisch nach unten zulaufen. Und das ergibt eine völlig andere Kontur am Horizont. Ich habe also noch gut 3 Stunden bis zum Abflug und möchte mir in dieser Zeit einen ersten Eindruck von Sao Paolo verschaffen. Der einzige Bus, den ich finden kann (der nicht einfach nur zur nächsten Metrostation führt, was mir zu umständlich und zu gefährlich ist), ist ein Flughafen-Hotelbus, und ich nehme ihn. Er soll eine Stunde fahren und eine Stunde zurück, das müsste sich ausgehen. Wir bekommen im Stadtzentrum einen Busbegleiter dazu, der die Gäste in die Hotels leiten soll, und er geht durch die Reihen, um die Hotelnamen zu erfahren. Mit italienisch komme ich nicht weiter, aber auch wenn die Transformation vom Wörterbuch einfach scheint, verstehe ich doch gar nichts und versteht man mich italienisch sprechend auch nicht. Die Verständigung gelingt schließlich durch die Vermittlung eines jungen Mannes, der auch englisch kann. Der Begleiter scheint sich über meine Zeitplanung aufzuregen, befürchtet, dass ich den Flug nicht erreiche, aber auch der junge Mann meint anerkennend, ich sei schon sehr mutig. Am Ende habe ich meinen Flug gut erreicht, auch wenn mich die langen Wartezeiten des Busses etwas genervt haben.
Sao Paolo macht auf mich zunächst einen recht bedrückenden Eindruck, man fährt erst direkt am Fughafen an sehr ärmlich aber doch immerhin gemauerten Hütten vorbei (die aber keine Favelas sind), später an recht verkommenen Betonhäusern im Stil der DDR-, später an ebenfalls recht verkommen aussehenden Hochhäusern. Später erst sehe ich, dass auch die Neubauten im Bauzustand schon einen baufälligen Eindruck an sich haben. Da es keine Sightseeingtour ist, sehe ich nur wenige ältere schönere Bauten, auch die wohl teuren Hotels finde ich nicht sehr einladend. Die Strassen gehen geradeaus die Hügel steil hinauf, was für Autos schon eine Herausforderung darstellt – aber es gibt ja keinen Schnee oder Eis im Winter. Es ist Sonntag und ganz leer in der Stadt, nur ein paar (Kunst-)Märkte sind bevölkert und die (neugotischen oder neoromanischen hässlichen) Kirchen haben einen gewissen, nicht allzu großen Zulauf. Die Flüsse und Kanäle, an denen wir vorbeikommen, haben eine graue Asphaltfarbe, kein Rest von grün, kaum vorstellbar, dass irgendein Leben in ihnen wohnt. Beim Rückweg habe ich mich schon etwas an den Eindruck gewöhnt und finde es nicht mehr so bedrückend. Jedenfalls scheint es mir nicht notwendig, hierhin nochmals für länger als das Einchecken am Flughafen zurückzukehren.
Man erreicht Florianopolis im Niedrigflug über das Meer, denn es ist eine kleine, dem Festland vorgelagerte Insel, sehr grün (hier ist allerdings jetzt Winter) und hügelig, wobei sich jeweils unten am Strand die Stadtteile um die Insel ziehen. Ich nehme ein Taxi zum Hotel und der Txifahrer ist begistert, dass ich mit ihm italienisch spreche, denn seine Mutter ist Italienerin. Überhaut ist die Provinz Santa Catarina geprägt durch italienisch-deutsche Einwanderung, was sich an Namen und Restaurants bemerkbar macht.
Die Insel ist länglich und von mehreren Gebirgen und Lagunen durchzogen, mit schönen Blicken und vielen schönen Stränden. Die Gebirge machen das Ganze recht unübersichtlich, oder vielleicht ist es die Straßenführung, jedenfalls kenne ich mich nie aus wo ich bin. Überdies gibt es eine sehr gehegte unter Naturschutz stehende lang gezogene ganz schmale Düne gleich bei meiner Herberge.
Mein Hotel Posada das Rendeiras (Herberge der Klöpplerinnen) direkt am wunderschönen Strand der Lagoa (Lagune) des Conceiaos (hier fehlen zwei wellige Akzente) besteht aus zwei Reihen von Appartements (insgesamt 14) an der Strasse, sehr laut, aber daran muss man sich in Brasilien ohnedies gewöhnen, es ist wohl überall laut. Es ist schön, das Bett ist gut, die Leute sehr sehr freundlich und hilfsbereit. Ich kann mich dort gut auf Italienisch verständigen, englisch ginge auch, aber offensichtlich ist die romanische Sprache den Leuten sympathischer. Die Strasse das Rendereidas ist gesäumt von Spitzenklöppeleien mit ihren bunten Produkten, und von Restaurants, auch für unsere Begriffe nicht billig (sonst ist das Leben ungefähr mit 1/3 unseres finanziellen Aufwands zu bewältigen), aber sehr angenehm: leichtes Krevetten- und Fischessen, mit Salat und Reis, was ich mir gerne genehmige. Im Ort gibt es jede Menge Geschäfte, Banken, Internetcafes, alles von mir genutzt. Die am besten bzw. eigentlich die für mich einzige funktionierende Bank ist, genau wie in Oman, die chinesische HSCB, die brasilianischen Banken sind eine Kette von Sicherheits-, bürokratischen und Desorganisations-Hindernissen, sie nehmen nur ihre eigenen Karten, in seltenen Fällen auch VISA, aber ich habe die Master Card. Es stellt sich heraus, dass man für die Flüge von Gol American Express bräuchte, für alles andere (Hotels) meist VISA. Auch garantiert eine internationale Master Card nicht die Annahme einer Institution, die Master Card verwendet, denn viele wollen die nationalen Master-Karten. So muss ich alles in kleinen Schlückchen bei HSBC bar abheben. Die Strassen sind mit 6-eckigen Beton-Schotterpflastersteinen ausgestattet, was ebenfalls zur Behinderung beiträgt (ich falle gleich über einen solchen Stein und schlage mich etwas auf), und vor allem zur Lautstärke des Straßenlärms. Ich bekomme wegen meiner 3 Wunden mit feuchtem Strassendreck Angst vor Tetanus und möchte zum Arzt, meine Hotelgastgeber führen mich zum Apotheker, der die Leute im Ort – umsonst, aber sehr kompetent - verarztet. Meine Gastgeber sagen, diese Arbeitsteilung habe sich hier herausgebildet, da die Arztbesuche viel zu aufwändig (meist muss man sich ins Krankenhaus aufnehmen lassen) und teuer (laut Internet teurer als bei uns) seien. Zudem sei er viel besser als die Ärzte, die heute nur in den Computer schauten, um die Laborbefunde anzusehen. In der Tat, wir warten ziemlich lang, aber der Apotheker verbindet mich und hält eine Tetanusspritze für unnötig. Dafür müsse ich in die Klinik aufgenommen werden, das ist mir auch zu viel Aufhebens. Ich denke, meine Abwehr wird das schon schaffen. Der Weg zur Universität ist eine Odyssee mit zweimal Umsteigen, aber ich setze mich einfach in einen Bus und hoffe, dass ich irgendwo ankomme – und das klappt tatsächlich. Auf dem Weg sehe ich, nur auf der rechten Seite, mindestens 11 Kliniken, und ebenso viele Apotheken. Im Zentrum angekommen, weist mich ein junger Student zum Anschlussbus zur Universität und zum Fahrkartenbüro, wo ich nach langem Warten eine Monatskarte für Touristen erstehe, mit der ich jederzeit überall hin fahren kann.
Die hellblauen Busse fahren in der im amerikanischen Stil mit vielspurigen Highways erschlossenen Stadt nahezu in kaum unterbrochener Reihenfolge. Es gibt tausende davon, sie sind alle seitlich nummeriert, die ich zunächst mit der Routennummer verwechselt habe. Auch der Routen sind an die Tausend, die höchste Routennummer, die ich gesehen habe, war 988 und die höchste Busnummer, die ich gesehen habe war 10.044. Ich muss, um an die Universität zu kommen, Busse, die je im ½ Stundentakt fahren, nehmen, zuerst 360 von/nach Barra de Lagoa, dann 320 von Lagoa de Paseideiras nach Trinidade, dann 180 nach USCB. Zurück habe ich heute 3 Stunden gebraucht, da ich den 320 in die falsche Richtung, bis zum Centro genommen habe (ist nicht erkennbar, es steht immer Lagoa da Pasedeiras darauf; inzwischen weiss ich, dass eine zusätzliches Metallschild für die Richtung gibt, das der Fahrer an den Endstationen umdrehen muss; aber nicht immer gibt es sie und nicht immer dreht er um). Sie alle sind unglaublich, am abenteuerlichsten aber der 320. Diese Busse müssen steil über den Berg, um von der Lagoa ins Zentrum zu kommen. Da gibt es Haarnadelkurven, die der Fahrer so sportlich wie eben möglich nimmt. Ich komme kaum die Stufen in der Eingangtüre hoch, und sie schaukeln so stark, dass ich mich kaum auf den Beinen halten kann, doch die Florianopolaner können das, offenbar mit einiger Übung. Wenn die Leute sehen, wie es mich durch den Bus schleudert, bieten sie mir einen Sitzplatz an, das hilft etwas, aber auch im Sitzen habe ich Schwierigkeiten, auf dem Sitz zu bleiben. An den Endhaltestellen TRICEN, TRITI oder TRILAG muss der Fahrer in Mäandern alle Bahnen abfahren, mit mindestens 5-9 Haarnadelkurven. Ich bin sicher, dieser Umweg ist dafür gemacht, damit die Fahrer ein wenig Spaß haben. Damit dem Schaffner, der auf einem erhöhten Sitz neben einem mit elektronischer Ausweiserkennung und -zählung ausgestatteten Drehkreuz sitzt, auch einiges abverlangt wird, ist ihm der Zugang zu seinem Sitz zur Turnübung gemacht worden: er kann sich entweder an den Haltestangen zum Feldaufschwung heben und so über das Drehkreuz mit den schwer armierten hohen Eisenbarrieren schwingen, oder sich auf die viel höhere Barriere neben seinem Sitz balancieren, was das Einrollen des ganzen Körpers in dem niedrigen Bus erfordert, und von dort auf seinen Sitz steigen. Beide Lösungen habe ich beobachtet. Was er nicht kann, ist durch die Barriere gehen, denn das würde die Zählung verfälschen. Überhaupt ist die Barriere sorgfältig ausgeklügelt: bei den erwähnten Endhaltestellen TRICEN etc. muss man sich mit Ausweiserkennung in den Wartebereich hineinbegeben und darf dann nicht vorne in den Bus einsteigen, da sonst doppelt gezählt würde, während man bei normalen Haltestellen vorne einsteigen muss und durch die Barriere und hinten aussteigen. Da aber die Behindertensitze vor dem Drehkreuz sind, müssen die Leute, die dort sitzen, zunächst warten und beim Aussteigen mit Ausweiserkennung durchs Drehkreuz. Ich habe hier noch keinen dicken Menschen gesehen: das Drehkreuz ist hier das effektive Mittel zur Schlankheit: man kommt nur durch, wenn man schlank ist, denn beim Durchwinden zwischen Drehkreuz und festen Stangen wird man erheblich gequetscht, schon die Tasche geht nicht mit durch, man muss alles hochheben, über das Drehkreuz, d.h. auch Gepäck verbietet sich, soweit es nicht klein und leicht genug ist, um es in Kopfhöhe über das Drehkreuz zu heben. (Jean-Pierre allerdings erklärt die schlanke Bevölkerung mit den vielen Stränden hier: das verbiete überdimensionale Fettpräsentation)
Nicht erwähnt habe ich, dass die Buslinienführung so ist, dass man ungefähr den 5-fachen Weg machen muss – eine Aufgabe für die Computeralgorithmik, aber wahrscheinlich unakzeptabel (eine Kollegin von mir hat einmal das Berliner Busliniensystem analysiert und einen Algorithmus für die beste Linienoptimierung hergestellt, doch die Lösung wurde nicht akzeptiert, denn sie hätte 1/3 der Arbeitsplätze gekostet und die Routen stark verändert), sodass meine beste Zeit 1,5 Stunden zur Universität ist, die schlechteste 3 Stunden.
Die Busse sind nur ein Beispiel dafür, wie man in Brasilien planerisch und organisatorisch versucht, den Menschen das Leben nicht zu angenehm werden zu lassen, wozu Landschaft und Meer, Klima und die Früchte des Landes ja geeignet wären. So wie bei Herzmanowsky-Orlando die 5. Klasse der kakanischen Eisenbahnwaggons, die unten keinen Boden haben, sodass die Leute mitlaufen müssen, um ihnen bei der Billigkeit der Fahrkarten das Mitfahren angemessen unangenehm zu machen. So sind die Stadtplanung und die Straßenführung ein Meisterwerk der Auto- und Ölindustrie, nämlich des maximalen Verbrauchs. Auf den Highways müssen immer wieder die Straßenseiten gewechselt werden, sodass man einmal rechts und einmal links des Gegenverkehrs fährt, das Abbiegen erfordert maximale Ortskenntnisse und Übung nicht nur im Stadtplan, sondern auch bezüglich der befahrbaren Straßenkanäle.
Übertroffen wird das Ganze nur durch die hervorragenden Leistungen der Architekten: Der Neubau des gelben Informatik-Institutsgebäudes INES, der nur halb fertig, aber schon bezogen ist, potthässlicher Stil der 70-er Jahre, ist ein Meisterwerk der Desorientierung im Sinne von Alices Spiegelland. Der ganz versteckte Eingang ist sogar wenn man davor steht, nur von einem bestimmten Winkel aus zu sehen, den man nur einnehmen kann wenn man sich in eine Sackgasse begibt. Will man das Gebäude dann betreten, muss man zuerst eine scharfe Rechtskurve, drinnen dann eine scharfe Linkskurve machen, der kanonische Gang nach rechts führt nur zu einem Gang mit einigen Räumen von Portieren und ist eine Sackgasse. Ist man nun scharf links abgebogen, so sieht man sich zwei Toiletten gegenüber (das ist schon nicht schlecht – diese sind im ganzen Land, übrigens auch an den großen Busstationen, sehr sauber, umsonst und von ausreichender Zahl im öffentlichen Raum). Rechts sieht man zwei ineinander verwinkelte tote dunkle Räume, die man nicht betreten würde, wäre da nicht grade jemand herausgekommen, aber genau dort beginnt wieder über diese 2 toten Räume mit einer scharfen Linkskurve der Einstieg zu einem riesigen weiten Treppenhaus und dem Aufzug. Also links, rechts, links und Du kommst hinauf. Bist Du nun auf dem gewünschten Stock, so hat sich der Architekt dasselbe Spiel für das Erreichen der Dienstzimmer ausgedacht: zuerst scharf nach rechts, dann nach links, in einem schwindligen S. Man geht weiter riesige weite Hallen, um mehrere Ecken, um am Ende in eine Sackgasse mit klitzekleinen Dienstzimmern zu gelangen, in denen sich je 6-8 Menschen drängen, die (3!) Sekretärinnen und die Organisatorin meines Kollegen sitzen auf engstem Raum im Gang, oder zusammen mit den Assistenten, an ihren – neuesten -Computern. Der zur Arbeit verwendbare Raum ist ungefähr ein Viertel des insgesamt umbauten Raums. Beim Verlassen der Räumlichkeiten bin ich nach wie vor so verwirrt und schwindlig wie beim ersten mal, auch wenn ich jetzt den Weg ohne Rückwärtsgehen finde.
Ähnlich, ja teilweise noch schlimmer organisiert sind die anderen Gebäude und der ganze Campus: mit Plan und dem Zeigefinger auf dem Plan weiß nie, wo ich mich befinde, finde aber irgendwie doch immer heraus. Das Hauptverwirrungselement sind hier die Brücken über die zahlreichen Kanäle oder Flüsschen im Campus. Muss man sie traversieren, so kann man nicht etwa dem Weg folgen, sondern muss erst nach einem Brückchen fahnden, versuchen, dieses zu erreichen, was mehrere Richtungswechsel nötig macht. Man geht über die Brücke, um danach wieder nach einem weiter führenden Weg zu suchen. Die beste Methode, weiter zu gehen, ist zu schauen wo man eigentlich hergekommen ist und sich dann zu vergegenwärtigen, wo man von dort aus eigentlich hin wollte. Nebenbei: auch hier im Campus sind die Flüsse stinkende graublaugrüne Kloaken, offenbar gibt es keine Abwasseraufbereitung und fast alles fließt ungeklärt in die Flüsse (deshalb darf man auch das Toilettenpapier nicht in den Lokus sondern muss es in einen eigenen Eimer werfen).
Dann kommt die nächste Aufgabe, den richtigen Bus zu nehmen, da auf allen UFSC (Universidad Federal de Santa Catarina) steht, aber das war ja die Zielrichtung. Die Beschränkung auf die Nr. 180 führt zu halbstündigen Wartezeiten, hat sich aber letztlich als die schnellste Variante herausgestellt. Oder man möchte die ganze 400.000 Einwohner große Stadt ergründen, die mir aber groß wie mindestens eine Millionenstadt vorkommt.