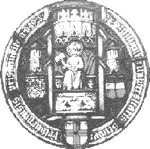
Windhuk, die Hauptstadt, liegt auf einer Hochebene ca 1800 m (genauer zwischen 16680 und 1900m) hoch, ist sehr heiß und extrem trocken, hat ca 180-190T Einwohner und ist meist neu gebaut und relativ hässlich. Der Stadtkern hatte eine Afrikanersiedlung verdrängt, die Leute wurden ausgesiedelt nach Katatura, einer ungeliebten sogenannten Location , wie hier die ärmeren, von Afrikanern bewohnten Viertel genannt werden. Katatura heißt auf deutsch: „der Ort, an dem wir nicht sein wollen“. Am Ortseingang sieht man ein Schild der 7-Tage-Adventisten, dann eines der Mission der guten Schwestern von Tutzing.
Die Straßennamen sind erstaunlich: in Klein Windhuk meist deutsch, aber auch afrikaans und englische Eigennamen, im Zentrum sind die wichtigsten Straßennamen von Kaiser Wilhelmstrasse, etc. durch Freiheitskämpfer ersetzt worden: Nelson Mandela, Hendrik Witbooi, Fidel Castro. Leider gibt es auch eine sehr prominente Robert Mugave Avenue, weil der Präsident von Zimbabwe ein enger Freund des Präsidenten Dr. Sam Nujoma ist, und auch der grässliche Laurence Kabila des ehemals belgischen Kongo bekommt diese Ehre. Aber es gibt keine Strassen für Idi Amin, Lumumba oder Kasawubu. Es gibt auch noch im Zentrum eine Gutenbergstrasse und andere deutsche Namen. Besonders absonderlich erscheint mir, dass die Studierenden der Polytechnic zwischen Beethoven-, Uhland- und Brahmsstrasse umhergehen oder eher –fahren – kaum jemand in Windhuk geht zu Fuß-, womit sie wohl kaum etwas anfangen können.
Wir essen im Restaurant Kaiserkrone, die als Aushängeschild tatsächlich mit der in der Wiener Schatzkammer aufbewahrten Aachener Kaiserkrone Ähnlichkeiten hat. Es gibt 2 ernst zu nehmende Buchhandlungen, eine deutsche und eine englische, letztere wirklich gut sortiert. Kultur ist sonst relativ wenig, aber es gibt Theater- und Konzertaufführungen, und natürlich viele afrikanische Musikgruppen.
Im Stadtzentrum sind Meteoriten auf Eisenpfählen ausgestellt, die aus 95% Eisen und 5% Nickel bestehen. Sie sehen, wo durchgeschnitten, aus, wie aus einem Hochofen gewonnener Edelstahl, sonst sind die vielen Einzelteile nahezu kugelförmig mit vielen konkaven Einbuchtungen. Es ist keine Aufschrift dabei, die besagte, ob der Meteorit in Windhuk gefunden wurde oder ob er etwa Bestandteil des die Etosha Pfanne eingedrückt habenden Meteoriten ist. Rund um dieses Ensemble stehen Straßenhändler mit ihren handgeschnitzten oder gedrechselten Schätzen aus Holz. Es sind Masken, Tierfiguren, Schüsseln und Körbe, Salatbestecke, Kerzenleuchter, u.s.w. Ich finde alle sehr schön, obgleich es sich ja nicht um Kunst handelt, sondern um Touristenware. Armin sagt, es gebe im Süden überhaupt keine afrikanische Kunst, von solcher könne nur in einem engeren Kreis vom Kongobecken, Mali bis Nigeria gesprochen werden; sie sei im Übrigen an die Sesshaftigkeit der Feldbauern gebunden, obgleich man diese Vorstellung von der Bedingung der Sesshaftigkeit für die Kunstproduktion jüngst in Ostafrika revidieren musste. In Mali haben die Bambara und die Dogon, die an ihre Wohnhöhlen gebunden sind - mit unglaublicher Lehm-Architektur, auch aus den Höhlen heraus - um Bandagara die bedeutendste Kunst. Die nördliche Elfenbeinküste, der Südrand der Sahara, mit Südrand von Obervolta, Guinea, Ghana und Togo, und natürlich Nigeria mit seinen 100 Millionen Einwohnern, und über 500 Millionen qkm, wobei im Norden die Haussa alle Kunst, insbesondere die hoch stehenden Benin-Bestände im Zuge der Islamisierung ausgerottet haben, diese aber nun mit der Kunst der Ibo, Ekoi, Mumue und vieler anderer nigerianischer Stämme handeln. Im Osten, in Tansania (Tansania war früher Deutsch Ostafrika, anfangs zusammen mit der Insel Sansibar, die letztere wurde aber schon vor dem 1. Weltkrieg an England abgetreten im Tausch gegen Helgoland, war also 1914 bereits britische Kolonie), wurde nun trotz Nomadentum mehr Kunst gefunden, als bisher angenommen, was in einem neuen Buch dokumentiert ist. Daher haben die Berliner Museen bedeutende Sammlungen afrikanischer Kunst zusammen rauben können, und übrigens hat auch das Wiener Kunsthistorische Museum einiges davon abbekommen. Kamerun und Togo wurden geteilt, der größere Teil von Kamerun, das heutige Kamerun wurde französisch, ein kleiner Teil ging an das britische Nigeria, Togo wurde je zur Hälfte britisch (das heutige Togo) und französisch (angegliedert an Dahomey), und zwar nicht als Kolonien, sondern als Völkerbund -Treuhandgebiete. Tansania ging an die Engländer und die Kolonien im Pazifik (Ost-Neuguinea, Bismark-Archipel etc.) wurden Völkerbund-Treuhandgebiete von Australien. Alle afrikanischen Kolonien wurden den Deutschen bereits zu Beginn des 1.WK weggenommen, erobert von den Aliierten, nur in Ostafrika konnten sie sich, wenn auch mit Mühe, bis 1918 halten.
Mein erster Vortrag an der Namibian Polytechnic Hochschule über die Frauenbeteiligung in der Informatik in verschiedenen Ländern und deren Gründe wurde von Studierenden des 2. Studienjahrs Informatik (hier gibt es 3 Studiengänge: Softwareentwicklung, Business software, network administration) brav angehört. Hier sind 40% Frauen in den 3 Informatik-Studiengängen, und sie werden sich gewundert haben, dass dies in Deutschland eine unerreichbar erscheinende Zahl ist. Der zweite Vortrag über e-learning wurde von berufstätigen Informatik-Studierenden gehört, die sehr klug und sympathisch aussahen, aufmerksam mit großen Augen zuhörten und sehr interessiert diskutierten. Ich habe nur einen weißen Studenten gesehen, ein Deutscher aus den neuen Ländern. Er sagt, für ihn sei der Kulturschock in den USA, wo er davor 1 Jahr war, wesentlich größer gewesen als jetzt in Namibia.
Bei meinem zweiten Aufenthalt in Windhuk (für den Workshop) ist es kälter und es gibt ein riesiges Gewitter, bei dem es 2 Stunden lang wie aus Scheffeln gegossen hat. Sofort läuft das Wasser in Strömen über die Strassen, kann sich, da es keine Gullis gibt nur in Senken und in den Flussbetten sammeln und schon ist alles geflutet. Die Flussbette sind unpassierbar, und die tiefsten Stellen der Stadt unter Wasser. Man muss aber nur ein paar Stunden warten, dann ist es wieder weg, abgeflossen durch die Flüsse, die oft nur wenige Stunden im Jahr Wasser führen.
Die Polytechnic ist ein neuer Baukomplex aus Beton, eingezäunt und mit Schranken, die freundliche Uniformierte nach Einholung von Auskünften über die Gründe für den Einlass aufmachen. Man ist äußerst freundlich bei solchen Gelegenheiten, erkundigt sich nach dem Befinden und beantwortet die Gegenfrage nach dem Befinden mit „very well“, fragt nach den neuesten Ereignissen, wie dem Independence day, wünscht ein schönes Wochenende, oder einen schönen Abend. Wann immer ich dort war, ob morgens, mittags oder spät abends, war die Universität höchst lebendig, gefüllt mit Studierenden, die jeweils offenen Hörsäle in Funktion und voll, die – sehr gut ausgestatteten - Computerlabs voll. Die Studierenden machen im Vergleich zu unseren, einen fröhlichen, angemessen selbstbewussten, klugen und zufriedenen Eindruck, sie lachen und scherzen, auch mit Heike, der der Senior Lecturer Informatik, die mich eingeladen hat, ohne großen Abstand. Ich habe insbesondere die Informatik-Studierenden sowohl bei meinen Vorträgen als auch beim Usability Workshop als höchst intelligent und kompetent kennen gelernt.
Eine Lecturer aus Deutschland kommt von SAP und lehrt dort im Rahmen des Studiengangs Businness Computing nichts anderes als SAP. SAP hat auch ein Computerlabor ausgestattet und es finden sich viele Plakate dieser Firma. Offenbar versucht sie, in Namibia über die Studierenden spezifische Kompetenz und damit einen Markt für sich aufzubauen.
Ich treffe auch den Rektor der Polytechnic – er ist Owambo - und sitzt in einem großen Raum mit aufgestellter namibischer Fahne, die Tür ist offen, man sieht ihn arbeiten - und habe ein längeres Gespräch mit der Verwaltungschefin, da eine Kooperation mit der Universität Freiburg für einen Austausch für den Masterstudiengang Informatik vereinbart werden soll. Es geht alles recht informell und problemlos, mal sehen, ob unsere Institutionen auch mit machen und welche Hürden unsere Verwaltung oder die Informatik in Freiburg sehen oder sich ausdenken werden. Die Sekretärin des Rektors hilft mir sofort, ein Fax zu schicken, es scheint alles bestens zu funktionieren. Heike findet das nicht ganz so, vor allem seit die Hochschule größer geworden ist wird vieles formalisierter. Trotzdem kann sie den Rektor jederzeit ansprechen, und wird von ihm sehr geschätzt und unterstützt.
Bei einem Meeting des Ministery of Environment and Tourism, welches Barbaras Projekt samt anderen transboundary wildlife Projekten koordiniert, der Namibia Nature Foundation, welche welcher Barbaras Projekt trägt und des World Wildlife Fonds, welcher Barbaras Projekt finanziert, bin ich mit eingeladen. Das Meeting findet im Amt der Namibian Nature Foundation statt, das im Kenia House untergebracht ist. Die Räume sind voller Tierplakate, aber auch voller Plakate, die Aidsinformationen enthalten. Überall liegen Präservative zur Bedienung herum. Die Sitzung ist sehr interessant, die Ministeriumsfrau (im Rang unseres Staatssekretärs) leitet die Sitzung höchst kompetent und mit sparsamen aber wichtigen Interaktionen. Es geht um den Fortgang und die Erweiterung von Barbaras Projekt auf andere transboundary species, wie Elefanten, Zebras, Nilpferde (Hippos) und Krokodile (diese sind zwar keine Mammalien, aber sie sind leicht mit den Hippos gemeinsam zu erfassen - Barbaras Projekt behandelt 3 Species, Büffel und zwei Antilopenarten, Sable und Roan). Die transboundary Kooperation bezieht sich darauf, dass vor allem in Caprivi, wo wegen der mäandernden Flussarme des Okavango river, mit seinem Delta in Botswana und den vielen verästelten Zuflüssen, wie Cutato river, Cuito, Cubango, etc. die meisten Tierarten leben und frei die Länder wechseln. Namibia reicht im Nordosten mit einem langen Arm in dieses Gebiet hinein und hat daher dort Grenzen zu Angola, Sambia, Zimbabwe und Botswana, an welche die Tiere sich nicht halten. Deshalb ist die Kooperation notwenig, konkret z.B. weil in Botswana derzeit die Elfanten geschossen werden, weil sie angeblich soviel Natur zerstören und sie damit nach Namibia getrieben werden, was in ein solches Management hineinwirkt. Später höre ich allerdings von Briony aus London, dass Botswana den namibischen Farmern vorwirft, die Elefanten zu schießen, die aus dem Chobe Naturschutzpark nach Namibia wechseln und dort ganze Patches in der Nähe von Wasserlöchern zertrampeln. Die Vorwürfe sind also wechselseitig, wobei die Naturparks versuchen, die Tiere zu erhalten, während die Farmer ihren Boden und die Pflanzen schützen wollen und daher die Elefanten abschießen, welche oft mal für einen einzigen Ast einen ganzen Baum ausreißen, großen Schaden anrichten können. Transboundary animals Projekte gibt es auch zwischen anderen afrikanischen Ländern, wie zwischen Malawi, Mozambique, Sambia, Tansania u.a.
Die Besprechung reichte von den Zuständen bzw. die zu planenden Veränderungen des wild life in Caprivi über Krokodil- und Rhino-Zählungen dort, wofür keiner Lust hatte, denn das kann recht unangenehm werden – Ben ein hoher Minsteriumsbeamter meinte, er sei zu alt dafür, in kürzester Zeit sein man mit einem Boot von 50 Rhinos eingekreist und dann gäbe es nur den einzigen Weg über deren Rücken hinweg hinaus - und demnächst statt findenden usability tests des transboundary information system durch Nutzerinnen und deren Evaluation durch die Studierenden der Polytechnic of Namibia in Windhuk, den Einfluss verschiedener Entscheidungsgruppen in verschiedenen Sitzungen auf die Modellierung des Systems roan, sable und buffalo management Plan, ein neues game transfer decision support system, den Finanzierungsbericht und die schwierige Kooperation mit Botswana, weil die damit befassten Beamten zwar alles sehr begrüßen würden, aber trotz vielfacher Anfragen und Angebote keine Entscheidungen über Konkretes der Kooperation treffen. Die Kooperation mit Wissenschaftlern wird aber auch als schwierig bezeichnet, da sie immer alles ändern wollen, überall Probleme sehen und Einfluss nehmen wollen – ein schöner Reflex auf meinen Berufsstand.
besteht aus einem Hypertext-Informationssystem und einem wissensbasierten Entscheidungs -unterstützenden System, das ein von der Universität Pittsburgh für die Landwirtschaft entwickeltes System NetWeaver benutzt und mit Wissen füllt.
Barbaras Hypertextsystem gibt Informationen, die für die Species Management Pläne wichtig sind. Ihr System setzt durch einen Consultant aus Zaire hergestellten Nachschlagewerke diese in Hypertext und kategorisiert und strukturiert die wichtigsten Informationen für die Management Pläne. Dieses System wird am 7. April am Polytechnic durch die Enduser, d.i. die Wildhüter, Konservatoren und Ministeriumsbeamten auf der einen Seite, denen eine Reihe von mit dem System zu lösenden Aufgaben gegeben wird, und die (direkt, über Video-Mitschnitte und durch Interviews) beobachtenden Informatik-Studierenden auf Usability evaluiert. Dafür hatten wir in Windhuk, und während der Reise Kategorien formuliert und sortiert, wobei wir u.a. auf Gender und alle Arten möglicher Diversity Rücksicht nehmen wollen. Wir nehmen an, dass sich sowohl solche der beruflichen Hintergründe wie auch ethnische Diversitäten zeigen werden. Eine weitere Metaevaluation der Ergebnisse der Studierenden erfolgt später von uns, Heike, Barbara und mir.
Das wissensbasierte Entscheidungs unterstützende System ist noch viel zu benutzungsunfreundlich, um es Usern zumuten zu können. Uz, der Informatik-Student soll die Benutzung, sobald von Barbara als endgültig modelliert freigegeben, für ein bequemeres Handling in seiner Thesis anpassen.
In Etosha versuchen wir, die Struktur der Roan-Antilope auf jene der black faced Impala-Antilope zu übertragen und wo nötig zu verändern. Die oberste Kategorie heißt translocation: angegeben wird die existierende Population (range expansion, mit ihrer historischen Verbreitung - hier fängt für ein wissensbasiertes System das Problem schon an: was ist historische Verbreitung?, wo setzen wir das Datum, ab wann menschliche Einflüsse eine Rolle spielen?, ab wann gibt es aktive Eingriffe durch Menschen, als Transfer – für Impala ist es in Etosha seit 30 Jahren) und wie muss ein Habitat aussehen? d.h. die Bedingungen für ihren Transfer in Gebiete, wo sie nicht verbreitet ist, sind zu eruieren. Impala braucht eine gewisse Menge Regen zwischen 150 und 350 mm, eine bestimmte passende Vegetation, um ihre vegetabile Ernährung zu sichern, deren Adäquatheit in Stufen und Farben in Karten aufgezeichnet ist (und in das NetWeaver-System explizit und über GIS aufgenommen wird, das eine vernetzte Struktur aus und/oder-Bäumen anzulegen erlaubt, mit Gewichten versehen, die eine fuzzy set Inferenzierung anstoßen kann, an die auch ein Graphik-, also Bild gebendes System GIS angeschlossen ist, das leider auch Fehler produziert), eine bestimmte Minimalanzahl (20) um bei Transfer in die Wildnis zu überleben, oder bei Transfer in eine Farm (10), und sie ist sensitiv gegen menschliche (und Nutzvieh-) Nähe.
Die fuzzy set Struktur lässt sich in beliebigen linearen Skalen von negativen (false-) Werten zu positiven (true-) Werten bewerten. Die passende Vegetation entsteht bei Regenfall zwischen 200 und 400mm, 100mm ist zu wenig, 600mm ist zu viel, daher setzen wir die fuzzy values von 100 mit 100% false, kontinuierlich zu 200mm mit 100% true, weiter bis 400mm 100% true und dann kontinuierlich absteigend zu 600mm als 100% false. Man muss jedoch unterscheiden zwischen dem gerade beschriebenen notwendigen Bedarf, der Toleranz der Tiere bzw. der Vegetation darüber hinaus und den strategischen Überlegungen: die Steuerung der Ausbreitung, wo man diese Tiere haben will. Die Begrenzung der Ausbreitung geschieht vor allem über die Regenmenge, die habitat, surface water und population density beeinflußt.
Das Tier braucht aber auch selbst Wasser, dies wird als surface water bezeichnet. Natürlich hängt das surface water vom rainfall ab, aber auch von den geologischen und geographischen und vielleicht auch kulturellen Bedingungen, von Temperatur, Trockenheit etc. Nun muss zwischen natürlichen und für den Menschen gemachten Waterholes unterschiedenen werden: Impala würde nicht aus Brunnen trinken, während die Roan-Antilope das ohne weiteres täte. Aber je mehr Wasser da ist, desto mehr wächst die menschliche Population mit Nutzvieh und desto schlechter für die Impala, die sensibel ist gegen Zivilisationseinflüsse. Barbara muss einen Knoten population density einfügen, da diese nicht nur auf der Ebene der Wassernutzung Einfluss auf die Speciespopulation hat. Sie versucht, dem obersten und/oder- Baum translocation mit habitat und range expansion, range expansion mit historic range, ein neues Blatt hinzuzufügen: population density und vergleicht es mit der Einfügung desselben Blattes auf der höheren Ebene translocation. Es führt zu nahezu den gleichen Ergebnissen, bei hohem Impact der population density. Die Einfügung liefert Karten, wo die Ausbreitung nur in den nordwestlichen Wüstengebieten möglich sein soll. (Die Populationskarte zeigt die größte Dichte im Norden Mitte und Nordosten.)
Das System läuft dann schlecht, wenn Unterkategorien eingeführt werden, da sich dann gleiche Dinge doppeln. Das liegt daran, dass die und-oder Struktur der und-oder Bäume (für die es aber effiziente Such- und Abarbeitungsalgorithmen gibt, z.B. A*-, B*-Algorithmus) es nicht erlaubt, Taxonomien unterzubringen, nur disjunkte Aufzählungen (oder) und notwendige Bedingungen (und). Daher müssen die Kategorien sehr sorgfältig gewählt werden, damit das vernetzte Wissen untergebracht und dennoch Überschneidungen vermieden werden.
Als output gibt das System also Karten, die zeigen, wo eine Art überleben kann/angesiedelt werden sollte. Dabei können die Gründe, warum das System welche Eintragungen gemacht hat (grün, rot, schwarz), mit Prozentangaben für die Gültigkeit zurückverfolgt werden, um die Gründe zu kennen und evtl. Korrekturen vorzunehmen: sind z.B. rain oder suitable vegetation type un/passend, oder ist die population density zu hoch, oder finden sich falsche Eintragungen, so kann sowohl die Modellierung als auch der Bewertungslevel zurück genommen werden und mit anderen Werten oder Strukturen gespielt werden. Es zeigt sich in unserem Modell, dass population density nicht notwendig schadet, denn die Karte verbietet Gebiete für Impala, obgleich dort gerade eine hohe Impala-Ansammlung ist, d.h. es zeigt sich, dass die menschliche Population dort die Species protectet. Werner schlägt vor, diese Evidenzen zum Backtracken positiver Populationen von homo sapiens sapiens zu verwenden, was wir aufgreifen. Dann könnte ein neuer Baum für population density aufgemacht werden, conservancy track record, der species-spezifische oder -unspezifische Protection-Eigenschaften von Populationen enthält. U.s.w.
Während der ganzen 2 Wochen besprechen wir die Aufgabenstellungen für die Enduser und die Evaluationskriterien, die die Informatik-Studierenden an die Bewertung der usability des Hypertext Informationssystems für das buffalo management anlegen sollen, d.h. welche Beobachtungen der Enduser dafür wichtig sind und welche Bewertungen des Systems sie wie aus diesen Beobachtungen ziehen sollen. Des Weiteren besprechen wir unsere Kriterien für eine Metaevaluation aus den audiovisuellen Dokumenten und den Bewertungen der Studierenden. So haben wir Mappen mit Fragen für beide professionellen Gruppen hergestellt, und mit verschiedenen Farben verschiedene Gruppen für unterschiedliche Fragestellungen zusammengestellt.
Die Vorbereitung ist aufwändig, am Abend vorher ist Heike, die auch bis 20 Uhr Lehre hat, am Zusammenbrechen, da nichts richtig funktioniert hat, und alles erst im letzten Moment aufgesetzt werden konnte. Das Audio funktioniert noch nicht. Die Polytechnic of Namibia ist abends bis 21 Uhr höchst belebt, alle Hörsäle sind voll - es gibt viele Studierende, die arbeiten und erst abends Zeit haben. Es sind kaum Weiße dabei, und man sieht, dass sie im Vergleich zu den oft noch recht kindlichen morgens Studierenden, älter sind. Die Studierenden sind lebendig, fröhlich und freundlich, sehen sehr klug aus und machen einen ausgesprochen sympatischen, interessierten Eindruck. Der Vergleich mit Deutschland drängt sich auf: bei uns viel mehr Missmut, Frust, Vorwurf, Ansprüche. Die – im Vergleich zu unserer Informatik-Ausstattung - vielen und großen Computerlabs sind aber auch hervorragend mit neuesten Rechnern und allen facilities ausgerüstet.
Am nächsten Morgen kann der Techniker die Audio-Störung beheben, wir haben auch alle Mappen fertig und die Studierenden machen die kompliziert mit Farben strukturierten Nametags. Am Workshop nehmen 13 Enduser, also Menschen, die in der Wildlife Conservation und im Wildlife Mangement arbeiten, davon 4 Frauen, teil, und sie werden von 16 Usability testers, also den Informatik-Studierenden, davon 4 Frauen, ein Portugiese, ein Deutscher aus den neuen Ländern, begleitet und beobachtet, und uns 4 Leiterinnen bzw. Metabeobachterinnen.
 |
 |
 |
Die Nature Conservators – man erkennt manche von ihnen auf den Fotos an den Uniformen des Minsitery of Environment - schwitzen ganz schön und sind durch die audiovisuellen Geräte eingeschüchtert. Eine Studentin meint, einen Fall von Technophobie festgestellt zu haben. Manche sind mit dem System gar nicht zufrieden und stellen inhaltliche Mängel bzw. überholte Darstellungen fest. Diese beantworten dann die Fragen aufgrund ihres Wissens und nicht des angeboteten Textes oder Systems, was auch erlaubt ist. Es gibt für alle ein sehr gutes Mittagessen mit Guavesaft, Reis, Gemüse und hartem Rindfleisch, das im Foyer herbeigezaubert wird. Am Ende haben wir eine lange Diskussion mit den Studierenden über die Ergebnisse. Es ist sehr lebendig und lustig, aber man merkt auch hier den Überlegenheitsgestus der InformatikerInnen gegenüber den Usern. Über Ostern haben sie als Aufgabe die Auswertung der Beobachtungen ihres jeweiligen Endusers, und sie verhandeln witzig und hart mit Heike darüber, noch mehr Zeit dafür zu bekommen. Aber sie bleibt klar und so akzeptieren sie es dann auch ohne Probleme.